As the following video is available only in English it would be much ado about nothing to comment on it in German – even more so as the European agency in question seems to be more recognizable under its English acronym EFSA than under its German title (Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit). Anyway, as the agencies of the European Union are scattered all over the continent the organization »committed since 2002 to ensuring that Europe’s food is safe« happens to be situated in Parma, Italy. Probably sending her message to the final frontier of virtual space called Internet from there, a lady with a nice Romanic accent explains why Bees are under threat. Not so long ago, the EFSA issued a press release that dealt with one critical point in the video (around 1:40): The harmful effects of pesticides for our small little honey-helpers. Neonicotinoids not only sound ugly, it is likely that at least three types of these substances pose a risk to bee colonies – clothianidin, imidacloprid and thiamethoxam.
As there are consultations in Brussels going on since late January whether or not the use of these neonicotinoids should be restricted in the European Union, these issues have news value. The petition power of the Internet is on its way, with the platform avaaz.org claiming to have millions of digital signatures for a ban of »bee poison«. Even though the bees, the flowers and the lady of EFSA in the video have only a few thousand clicks, I would recommend not only to sign a petition but also to watch the video or even read the press release. The success of the documentary »More than Honey« is another indicator that it is more at stake than a dark full-grain bread with golden honey for breakfast.
Press release of EFSA: http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/130116.htm
2013/02/09
2013/01/25
Kommentar zu europäischen Perspektiven von Bischof Dr. Markus Dröge
Seit 2009 ist Bischof Dr. Markus Dröge der Nachfolger von Bischof Prof. Dr. Dr. h. c. Wolfgang Huber an der Spitze der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO). Gelegentlich äußert er sich auch zu europäischen Themen. Anlässlich des Taizétreffens in Berlin Ende 2011 deutete er an, dass »gegenseitiges Verständnis« heute, in Zeiten einer »globalisierten Welt«, nötiger sei denn je. Die Taizégemeinschaft bezeichnete er als ein internationales »Netzwerk, das auch durch die jährlichen Europäischen Jugendtreffen zusammengehalten wird«. Nebenbei bemerkt: Das nächste Europäische Jugendtreffen findet im deutsch-französischen Jubeljahr 2013 passenderweise in Straßburg statt.
Im Zusammenhang mit der europäischen Öffentlichkeit und zivilgesellschaftlichen Strukturen in Europa berief sich Dröge kürzlich auf Immanuel Kant. Dieser habe in seinem Buch »Zum ewigen Frieden« drei wichtige Prinzipien herausgestellt. Also gibt der interessierte Zeitgenosse mal eben jene drei Worte bei einer Suchmaschine seines Nicht-Vertrauens ein. Die erste Überraschung bilden die Finger des Scan-Menschen, eheberingt und mit kleinen rosa Blätterhilfen quasi befingerhutet. Die nächste Überraschung bietet der erste Satz mit Bezug zu dem Titel der Schrift (in feinster Fraktur): »Ob diese satyrische Ueberschrift auf dem Schilde jenes holländischen Gastwirths, worauf ein Kirchhof gemahlt war, die Menschen überhaupt, oder besonders die Staatsoberhäupter, die des Krieges nie satt werden können, oder wohl gar nur die Philosophen gelte, die jenen süßen Traum träumen, mag dahin gestellt seyn.«
Sucht man nun nach dem ersten Punkt, auf den Dröge anspielt, findet man Kants Ausführungen zum Friedensbund (foedus pacificum), der von einer Republik »(die ihrer Natur nach zum ewigen Frieden geneigt seyn muß)« ausgehen müsse. Zum zweiten Punkt, Frieden durch Freihandel, findet sich zum Beispiel eine schöne Anmerkung, in der Kant »die Natur« als Friedensstifter zwischen Bewohnern der »Eisküsten« und der »temperirten Erdstriche« auftreten lässt, die friedvoll miteinander Holz gegen »Produkte aus dem Thierreich« tauschen werden.
Der dritte Punkt schließlich passt tatsächlich gut in unsere Zeit, obwohl er aus ganz anderen Kontexten von Kant entwickelt wird: »Da es nun mit der unter den Völkern der Erde einmal durchgängig überhand genommenen (engeren oder weiteren) Gemeinschaft so weit gekommen ist, daß die Rechtsverletzung an einem Platz der Erde an allen gefühlt wird: so ist die Idee eines Weltbürgerrechts keine phantastische und überspannte Vorstellungsart des Rechts, sondern eine nothwendige Ergänzung des ungeschriebenen Codex, sowohl des Staats- als Völkerrechts zum öffentlichen Menschenrechte überhaupt, und so zum ewigen Frieden, zu dem man sich in der continuirlichen Annäherung zu befinden, nur unter dieser Bedingung schmeicheln darf.«
Es stellt sich allerdings schon die Frage, ob es legitim ist, wie Dröge eine transnationale Öffentlichkeit mit Christinnen und Christen als aktiven Bürgern für ein lebendiges Europa aus dem ersten Teil des Kantischen Bandwurmsatzes abzuleiten. In meinen Augen sollte man die scheinbar noch hoffnungsloser verstrickten Ansätze einer Weltgemeinschaft nicht aus den Augen verlieren – egal welcher Religion oder Nicht-Religion man sich verpflichtet sieht. Das kann und wird sicher auch der ehemalige Vorsitzende des Aufsichtsrates des Evangelischen Entwicklungsdienstes (eed) bei Gelegenheit unterstreichen.
Die Ausführungen zum Taizétreffen finden sich als Text auch auf den Seiten der EKBO:
http://www.ekbo.de/bischof/1058819/
Die Überlegungen zur europäischen Öffentlichkeit wurden in der Gemeindezeitung der Evangelischen Auengemeinde in Berlin-Wilmersdorf (Dezember 2012/Januar 2013) veröffentlicht:
www.auenkirche.de
Im Zusammenhang mit der europäischen Öffentlichkeit und zivilgesellschaftlichen Strukturen in Europa berief sich Dröge kürzlich auf Immanuel Kant. Dieser habe in seinem Buch »Zum ewigen Frieden« drei wichtige Prinzipien herausgestellt. Also gibt der interessierte Zeitgenosse mal eben jene drei Worte bei einer Suchmaschine seines Nicht-Vertrauens ein. Die erste Überraschung bilden die Finger des Scan-Menschen, eheberingt und mit kleinen rosa Blätterhilfen quasi befingerhutet. Die nächste Überraschung bietet der erste Satz mit Bezug zu dem Titel der Schrift (in feinster Fraktur): »Ob diese satyrische Ueberschrift auf dem Schilde jenes holländischen Gastwirths, worauf ein Kirchhof gemahlt war, die Menschen überhaupt, oder besonders die Staatsoberhäupter, die des Krieges nie satt werden können, oder wohl gar nur die Philosophen gelte, die jenen süßen Traum träumen, mag dahin gestellt seyn.«
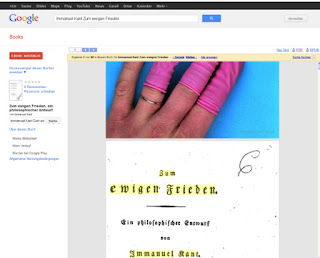 |
| Bildschirmdruck: books.google.de (25.1.2013) |
Sucht man nun nach dem ersten Punkt, auf den Dröge anspielt, findet man Kants Ausführungen zum Friedensbund (foedus pacificum), der von einer Republik »(die ihrer Natur nach zum ewigen Frieden geneigt seyn muß)« ausgehen müsse. Zum zweiten Punkt, Frieden durch Freihandel, findet sich zum Beispiel eine schöne Anmerkung, in der Kant »die Natur« als Friedensstifter zwischen Bewohnern der »Eisküsten« und der »temperirten Erdstriche« auftreten lässt, die friedvoll miteinander Holz gegen »Produkte aus dem Thierreich« tauschen werden.
Der dritte Punkt schließlich passt tatsächlich gut in unsere Zeit, obwohl er aus ganz anderen Kontexten von Kant entwickelt wird: »Da es nun mit der unter den Völkern der Erde einmal durchgängig überhand genommenen (engeren oder weiteren) Gemeinschaft so weit gekommen ist, daß die Rechtsverletzung an einem Platz der Erde an allen gefühlt wird: so ist die Idee eines Weltbürgerrechts keine phantastische und überspannte Vorstellungsart des Rechts, sondern eine nothwendige Ergänzung des ungeschriebenen Codex, sowohl des Staats- als Völkerrechts zum öffentlichen Menschenrechte überhaupt, und so zum ewigen Frieden, zu dem man sich in der continuirlichen Annäherung zu befinden, nur unter dieser Bedingung schmeicheln darf.«
Es stellt sich allerdings schon die Frage, ob es legitim ist, wie Dröge eine transnationale Öffentlichkeit mit Christinnen und Christen als aktiven Bürgern für ein lebendiges Europa aus dem ersten Teil des Kantischen Bandwurmsatzes abzuleiten. In meinen Augen sollte man die scheinbar noch hoffnungsloser verstrickten Ansätze einer Weltgemeinschaft nicht aus den Augen verlieren – egal welcher Religion oder Nicht-Religion man sich verpflichtet sieht. Das kann und wird sicher auch der ehemalige Vorsitzende des Aufsichtsrates des Evangelischen Entwicklungsdienstes (eed) bei Gelegenheit unterstreichen.
Die Ausführungen zum Taizétreffen finden sich als Text auch auf den Seiten der EKBO:
http://www.ekbo.de/bischof/1058819/
Die Überlegungen zur europäischen Öffentlichkeit wurden in der Gemeindezeitung der Evangelischen Auengemeinde in Berlin-Wilmersdorf (Dezember 2012/Januar 2013) veröffentlicht:
www.auenkirche.de
2012/12/27
Einmal Europapolitik, dann lieber Reiseführer
 |
| Aggro ICE - (c) ELE |
Ich atme fast hörbar für andere Mitreisende auf, als in der Reportage ein Lehrer aus England auftaucht, der »seiner Klasse ein paar Fakten« beibringt. Doch leider geht es zwar um das ungarische Paralament, aber letztlich erfährt der oder die persönlich von der Deutschen Bahn Beschenkte nur, dass sein Gebäude sich architektonisch am Westminster Palace orientiert. Was polititsch in Ungarn los war und ist, darüber schweigt sich das Magazin leider aus. Ist schon klar, dass Feinheiten zu ungarischer Innenpolitik, Ungarns Geschichte im 20. Jahrhundert oder zu Sanktionsmechanismen und ihren Grenzen in der gegenwärtigen Europäischen Union nicht in einen Reisebericht gehören. Einen Hinweis auf die europapolitische Herausforderung, die die aktuelle ungarische Parlamentsmehrheit und Regierung darstellt, hätte in Kontinuität zur Titelgeschichte des vorangegangenen Heftes allerdings auch nicht geschadet. Schon ein wenig eigenartig, dass »mobil« 12.2012 die Fahne europäischer Völkerverständigung hochhält und die Ausgabe 01.2013 zur Unabhängigkeit von Justiz und Medien im Staat des ehemaligen Gulaschkommunismus nichts zu sagen hat. Klar ist Budapest nicht mit der Regierung in Budapest gleichzusetzen, aber selbst im Internet bleibt das Magazin offenkundig bei süßlich Unverfänglichem: »Sweet Budapest: Eine Bildergalerie und ein Rezept für Esterhazy-Torte finden Sie auf dbmobil.de«
2012/11/30
Friedensnobelpreis und Ungleichheit
Die Friedensnobelpreisträgerin 2012 ist schon wieder mit ganz anderen Nachrichten in den Schlagzeilen. Der Friedensnobelpreisträger 2009 war zwar in diesem Monat in aller Munde, kaum jemand hat jedoch an diese Auszeichnung Obamas erinnert, wichtiger ist die Nachwahlherausforderung mit der schönen Überschrift »fiscal cliff«. Nun ist das mit dem Frieden so eine Sache. Ein anderer Nobelpreisträger – der Wirtschaftswissenschaftler Joseph Stiglitz – war nämlich mit Analysen, wie Ungleichheit Gesellschaft im Sinne von Unfrieden teuer zu stehen kommt, in Deutschland erfolgreich »auf Tour«.
Überhaupt scheint die gute alte Ungleichheit wieder ein zugkräftiges Thema zu sein. Wie man liest, erscheint im Frühjahr voraussichtlich ein neues Opus von Hans-Ulrich Wehler in der »Beck’schen Reihe« dazu. In meinen Augen liegt in dem Thema zugleich die Aufgabe für die Friedensnobelpreisträgerin dieses Jahres – schon in den ersten Reaktionen nach der Bekanntgabe der Entscheidung unterstrichen die Kommentatorinnen und Kommentatoren, dass das nicht eingehaltene Versprechen des gesellschaftlichen Zusammenwachsens in Europa eine Bürde für die Zukunft sei. Es bleibt trotz der Jugoslawienkriege der 1990er Jahre eine preiswürdige Leistung, viele »Erbfeindschaften« des Kontinents scheinbar ad acta gelegt zu haben. Wenn der äußere Frieden jedoch mit innerem Unfrieden einhergehen wird, ist die Frage zu stellen, ob die EU sich wirklich um den Frieden verdient gemacht hat.
Überhaupt scheint die gute alte Ungleichheit wieder ein zugkräftiges Thema zu sein. Wie man liest, erscheint im Frühjahr voraussichtlich ein neues Opus von Hans-Ulrich Wehler in der »Beck’schen Reihe« dazu. In meinen Augen liegt in dem Thema zugleich die Aufgabe für die Friedensnobelpreisträgerin dieses Jahres – schon in den ersten Reaktionen nach der Bekanntgabe der Entscheidung unterstrichen die Kommentatorinnen und Kommentatoren, dass das nicht eingehaltene Versprechen des gesellschaftlichen Zusammenwachsens in Europa eine Bürde für die Zukunft sei. Es bleibt trotz der Jugoslawienkriege der 1990er Jahre eine preiswürdige Leistung, viele »Erbfeindschaften« des Kontinents scheinbar ad acta gelegt zu haben. Wenn der äußere Frieden jedoch mit innerem Unfrieden einhergehen wird, ist die Frage zu stellen, ob die EU sich wirklich um den Frieden verdient gemacht hat.
2012/10/07
Perspektiven auf ein dunkles Europa
Auf Empfehlung ist in diesem Blog-Beitrag von zwei Romanen des deutschen Autors Wolfram Fleischhauer die Rede, in denen in meinen Augen ein »dunkles Europa« eine Rolle spielt. Gut zu wissen, dass Fleischhauer (Jahrgang 1961) Erfahrung als Konferenzdolmetscher in Brüssel hat. Offensichtlich haben es ihm dabei vor allem Französisch und Englisch angetan. Der erste Roman, in dem Französisch gefragt ist, »Die Frau mit den Regenhänden« entführt einen in zwei Zeitebenen. Ort ist jeweils Paris, die »Stadt des Lichts«. Warum dann von einem »dunklen Europa« fabulieren?
Die erste Zeitebene führt kurz vor die Zeit des deutsch-französischen Krieges von 1870/71, die zweite in den Anfang der 1990er Jahre, eine Zeit in der sich die »Nachbarn am Rhein« (Hartmut Kaelble) neu in einer Welt »après-guerre-froide« zurechtfinden mussten. Mitreißend erzählt Fleischhauer, wie eine gerichtliche Ermittlung im 19.-Jahrhundert-Paris immer größere Kreise zieht – als Hauptstadt von Frankreich und als Ort der Weltausstellung erscheint die Stadt zunächst übermächtig glänzend. Doch es liegen bereits lange Schatten auf dem Zweiten Kaiserreich, am Ende zitiert der Autor die Kaiserin: »In keinem Land, so bemerkte sie, sei der Abstand zwischen Erhabenheit und Lächerlichkeit so gering.« (S. 480) Während diese Kriminalgeschichte um einen vermeintlich »alltäglichen« Kindesmord immer rasanter vorwärtsgeht, wird klar, dass sie eine Geschichte in der Geschichte ist. Anfang der 1990er Jahre begegnet ein deutscher Doktorand in einem Lesesaal einer rätselhaften Französin, die den Skandal im Schatten der Pariser Weltausstellung wie besessen recherchiert. Hier setzt Fleischhauer vor allem auf die Liebesgeschichte, deren Ausgang und ebenfalls dunkle Hintergründe hier nicht verraten werden sollen. Dennoch kommt die Vergangenheit wieder zum Vorschein, wenn eine Vertraute der Französin den Doktorarbeits-Geplagten direkt angeht: »›Warum studiert ein Deutscher französische Geschichte?‹« (S. 405)
Eine gute Frage, die ich aus eigenen, ähnlichen intellektuellen Entwicklungslinien vielleicht noch um die Frage erweitern würde: Warum studiert ein Deutscher europäische Geschichte? Meine Antwort 2012, circa zwei Jahre vor einem runden Jahrestag eines Kristallisationspunktes des dunklen Europas, von dem die Rede ist: Weil es nicht ausreicht, die vermeintlich eigene Perspektive zu kennen.
Im zweiten Roman von Fleischhauer, »Schule der Lügen«, geht es wieder scheinbar um keinerlei europäische Katastrophen. Erneut steht ein Ort im Mittelpunkt, Berlin, wobei es mehr Nebenschauplätze gibt, einen Adelssitz bei Hamburg, das koloniale Indien, das Zentrum des britischen Weltreichs London (daher geht es sprachlich hier mehr um das Englische) … Dafür steht eine Zeitebene im Mittelpunkt, die Mitte der 1920er Jahre. Wiederum geht es mit nervenaufreibender Spannung um politische Machenschaften und Liebesverwicklungen, die sich hier mit einer deutschen Oberklasse-Familiengeschichte verbinden. Edgar Falckenbeck-von Rabov, Erbe eines Hamburgischen Industriellen, kommt den dunklen Flecken auf seinem bis dato glänzenden Familienstammbaums auf die Spur. Dabei sei nur am Rande ein wenig genealogische Rechthaberei erlaubt. Der von Edgar im Zuge seiner Recherchen skizzierte Stammbaum seiner beiden Familienzweige (S. 141) weist für die Nachkommen des verfehmten, nach England gegangenen Onkels zwei Söhne und eine Tochter auf, während zwei Töchter und ein Sohn (z. B. S. 126) richtig ist. Wichtiger ist aber auch hier der Hintergrund der Geschichte, den beispielsweise der ausgestoßene Onkel beiläufig auf den Punkt bringt, als er über den Bruch zwischen ihm und seinem Vater, dem Großindustriellen, spricht: »›[…] mein Vater war ebenso wie seine alldeutschen Freunde fest davon überzeugt, Deutschland und Österreich, das Germanenreich sozusagen, könnten es mit dem Rest der Welt aufnehmen. Nun ja, das Ergebnis kennen wir.‹« (S. 293)
Meiner Meinung nach ist das Ergebnis dieses dunklen Europas aus dem Blut von Millionen auch 2012, 98 Jahre nach »Deutschland und Österreich gegen den Rest der Welt« noch nicht abzusehen. Aber es ist notwendig, die Spuren dieser langen Geschichte nicht nur an den großen Jahrestagen im Auge zu behalten.
Wolfram Fleischhauer, Die Frau mit den Regenhänden, Taschenbuch Knaur, München 2001 [1999], 481 Seiten, 9,95 €.
Wolfram Fleischhauer, Schule der Lügen, Piper, München 2006, 523 Seiten, 22,90 € (unter dem Titel »Die Inderin« im gleichen Verlag 2008 für 10,95 € auch als Taschenbuch erschienen).
Die erste Zeitebene führt kurz vor die Zeit des deutsch-französischen Krieges von 1870/71, die zweite in den Anfang der 1990er Jahre, eine Zeit in der sich die »Nachbarn am Rhein« (Hartmut Kaelble) neu in einer Welt »après-guerre-froide« zurechtfinden mussten. Mitreißend erzählt Fleischhauer, wie eine gerichtliche Ermittlung im 19.-Jahrhundert-Paris immer größere Kreise zieht – als Hauptstadt von Frankreich und als Ort der Weltausstellung erscheint die Stadt zunächst übermächtig glänzend. Doch es liegen bereits lange Schatten auf dem Zweiten Kaiserreich, am Ende zitiert der Autor die Kaiserin: »In keinem Land, so bemerkte sie, sei der Abstand zwischen Erhabenheit und Lächerlichkeit so gering.« (S. 480) Während diese Kriminalgeschichte um einen vermeintlich »alltäglichen« Kindesmord immer rasanter vorwärtsgeht, wird klar, dass sie eine Geschichte in der Geschichte ist. Anfang der 1990er Jahre begegnet ein deutscher Doktorand in einem Lesesaal einer rätselhaften Französin, die den Skandal im Schatten der Pariser Weltausstellung wie besessen recherchiert. Hier setzt Fleischhauer vor allem auf die Liebesgeschichte, deren Ausgang und ebenfalls dunkle Hintergründe hier nicht verraten werden sollen. Dennoch kommt die Vergangenheit wieder zum Vorschein, wenn eine Vertraute der Französin den Doktorarbeits-Geplagten direkt angeht: »›Warum studiert ein Deutscher französische Geschichte?‹« (S. 405)
Eine gute Frage, die ich aus eigenen, ähnlichen intellektuellen Entwicklungslinien vielleicht noch um die Frage erweitern würde: Warum studiert ein Deutscher europäische Geschichte? Meine Antwort 2012, circa zwei Jahre vor einem runden Jahrestag eines Kristallisationspunktes des dunklen Europas, von dem die Rede ist: Weil es nicht ausreicht, die vermeintlich eigene Perspektive zu kennen.
Im zweiten Roman von Fleischhauer, »Schule der Lügen«, geht es wieder scheinbar um keinerlei europäische Katastrophen. Erneut steht ein Ort im Mittelpunkt, Berlin, wobei es mehr Nebenschauplätze gibt, einen Adelssitz bei Hamburg, das koloniale Indien, das Zentrum des britischen Weltreichs London (daher geht es sprachlich hier mehr um das Englische) … Dafür steht eine Zeitebene im Mittelpunkt, die Mitte der 1920er Jahre. Wiederum geht es mit nervenaufreibender Spannung um politische Machenschaften und Liebesverwicklungen, die sich hier mit einer deutschen Oberklasse-Familiengeschichte verbinden. Edgar Falckenbeck-von Rabov, Erbe eines Hamburgischen Industriellen, kommt den dunklen Flecken auf seinem bis dato glänzenden Familienstammbaums auf die Spur. Dabei sei nur am Rande ein wenig genealogische Rechthaberei erlaubt. Der von Edgar im Zuge seiner Recherchen skizzierte Stammbaum seiner beiden Familienzweige (S. 141) weist für die Nachkommen des verfehmten, nach England gegangenen Onkels zwei Söhne und eine Tochter auf, während zwei Töchter und ein Sohn (z. B. S. 126) richtig ist. Wichtiger ist aber auch hier der Hintergrund der Geschichte, den beispielsweise der ausgestoßene Onkel beiläufig auf den Punkt bringt, als er über den Bruch zwischen ihm und seinem Vater, dem Großindustriellen, spricht: »›[…] mein Vater war ebenso wie seine alldeutschen Freunde fest davon überzeugt, Deutschland und Österreich, das Germanenreich sozusagen, könnten es mit dem Rest der Welt aufnehmen. Nun ja, das Ergebnis kennen wir.‹« (S. 293)
Meiner Meinung nach ist das Ergebnis dieses dunklen Europas aus dem Blut von Millionen auch 2012, 98 Jahre nach »Deutschland und Österreich gegen den Rest der Welt« noch nicht abzusehen. Aber es ist notwendig, die Spuren dieser langen Geschichte nicht nur an den großen Jahrestagen im Auge zu behalten.
Wolfram Fleischhauer, Die Frau mit den Regenhänden, Taschenbuch Knaur, München 2001 [1999], 481 Seiten, 9,95 €.
Wolfram Fleischhauer, Schule der Lügen, Piper, München 2006, 523 Seiten, 22,90 € (unter dem Titel »Die Inderin« im gleichen Verlag 2008 für 10,95 € auch als Taschenbuch erschienen).
2012/09/27
Wissenschaft – es ist eine Menschensache!
Vor einiger Zeit geisterte eine Diskussion um ein peinliches Werbevideo
der EU durch die Medien. Die Aufmerksamkeit liegt derzeit
verständlicherweise bei anderen »Internetvideo-Debatten«, dennoch lohnt
sich ein zweiter Blick mit etwas zeitlichem Abstand. Was war geschehen?
Kommentare echauffierten sich zu Recht über ein klischeetriefendes
Videofilmchen. Die EU-Kommission hatte es für 102.000 € (http://science-girl-thing.eu/files/about/about-science-girl-thing-en.pdf)
in Auftrag gegeben, um Wissenschaft attraktiver, weniger männlich
dominiert zu präsentieren. Im Nachhinein fragte ein
süddeutsche.de-Kommentar entgeistert, mit welcher Brille die beauftragte
Agentur wohl an ihren Job herangegangen sei (http://www.sueddeutsche.de/bildung/missglueckte-eu-kampagne-mit-minirock-und-high-heels-ins-labor-1.1394628-2?commentCount=11&commentspage=1#kommentar1687354).
Die Schaltzentrale in Brüssel zog daraufhin die Reißleine, nahm das
Video von ihrer Seite und warf die Twitter-Maschine an, um unter
#realwomeninscience die Debatte in ein ruhigeres Fahrwasser zu lenken.
Fazit: Erstens ist die Krisen-PR der Verantwortlichen aufschlussreich –
da wird mit einem Hashtag bei einer US-amerikanischen Mikroblog-Firma
und einem dürren PDF-Schreiben versucht, der Diskussion den Wind aus den
Segeln zu nehmen. Zweitens weisen die kritischen Kommentare bereits in
die richtige Richtung. Im europäischen Entscheidungszentrum scheint es
weiterhin eine altmodisch strenge Trennung zwischen »science« &
»humanities« zu geben und darüber hinaus ein angestaubtes Repertoire an
Stereotypen, was Chancengleichheitsprobleme sind und wie man damit
umgehen sollte. Es ist löblich, sich der »Geschichten einiger der
Heldinnen europäischer Wissenschaft« bewusst zu werden (Seite 5 in der
PDF-Version der Sammlung unter http://ec.europa.eu/research/audio/women-in-science/pdf/wis_en.pdf#view=fit&pagemode=none).
Dabei darf die EU trotz schicker und teurer Kampagnen aber nicht
übersehen, dass nicht nur »girls«, sondern überhaupt verschiedene
Menschen der Wissenschaft in Europa gut tun würden. Und ich meine jetzt
nicht nur »science«.2012/08/27
Tempelhof Airport – the European Grandmaster of Noise
Especially for global p(l)ayers, the former airport in Berlin-Tempelhof seems to have a fascination going way beyond practical aspects. Newest example: »Campus Party™ – Europe in Berlin« with its main actors Telefonica | O2 and the European Commission. The weather was not the best during the time span 21st to 26th of August and – even worse – the airplane hangars provide for horrible acoustics if there are as many stages as in this case. This holds true even though or precisely because not all seats were in use in front of every stage. Tempelhof seems to have enough tech-appeal to be the place for hackers, bloggers and wannabes (like me).
The panel I discuss here had the interesting title »Tools and Strategies to hack the European Union«. Noteworthy on a stage paid for in part by the European Commission, that is. Discussiants were Sandra Mamitzsch (Digitale Gesellschaft e. V.) and Katarzyna Szymielewicz (Panoptykon), both active in the umbrella organization EDRI (European Digital Rights). Of course, the panel seemed a little hyped by the vote against the ACTA treaty. Katarzyna Szymielewicz, who is also a member of the EDRI Board, started the panel with a »commercial« for EDRI and its main issues.
Even though there was a serious effort by both discussants to not talk too much about ACTA, the issue came back in the game when they went into the campaigning challenges. The easy aspect of the European Parliaments vote was in the view of both activists that it was just necessary to get the Members of Parliament to vote against the proposed regulation. Understandably, it is much more difficult to bring forward an initiative, e. g. for a reformed copyright.
At this future-oriented part of the discussion the mentioned Tempelhof atmosphere was taking its toll more and more. As Katarzyna Szymielewicz was explaining why »self regulation« in the Internet sector does not always work in a good way, the noise on the main stage just a few meters away reached crisis level. The »hacking attempt« against the European Union had to be aborted. By the way, on the main stage Neelie Kroes, the European Commissioner for Digital Agenda, was enjoying the acoustic aura.
The panel I discuss here had the interesting title »Tools and Strategies to hack the European Union«. Noteworthy on a stage paid for in part by the European Commission, that is. Discussiants were Sandra Mamitzsch (Digitale Gesellschaft e. V.) and Katarzyna Szymielewicz (Panoptykon), both active in the umbrella organization EDRI (European Digital Rights). Of course, the panel seemed a little hyped by the vote against the ACTA treaty. Katarzyna Szymielewicz, who is also a member of the EDRI Board, started the panel with a »commercial« for EDRI and its main issues.
Even though there was a serious effort by both discussants to not talk too much about ACTA, the issue came back in the game when they went into the campaigning challenges. The easy aspect of the European Parliaments vote was in the view of both activists that it was just necessary to get the Members of Parliament to vote against the proposed regulation. Understandably, it is much more difficult to bring forward an initiative, e. g. for a reformed copyright.
At this future-oriented part of the discussion the mentioned Tempelhof atmosphere was taking its toll more and more. As Katarzyna Szymielewicz was explaining why »self regulation« in the Internet sector does not always work in a good way, the noise on the main stage just a few meters away reached crisis level. The »hacking attempt« against the European Union had to be aborted. By the way, on the main stage Neelie Kroes, the European Commissioner for Digital Agenda, was enjoying the acoustic aura.
Subscribe to:
Posts (Atom)